Nach wie vor gehen laut FAO-Statistik jährlich 15 Millionen Hektar Tropenwald verloren, das ist mehr als die gesamte Waldfläche der Bundesrepublik Deutschland. Eine Hauptursache für die Vernichtung des Tropenwaldes ist seine Inanspruchnahme für landwirtschaftliche Zwecke, sei es im Zuge des kleinbäuerlichen Wanderfeldbaus und der Weidewirtschaft oder in großem Maßstab durch die Anlage von Plantagen zur stofflichen oder energetischen Nutzung. Die Folgen sind gravierend: Die landwirtschaftliche Nutzung gefährdet die Humusvorräte, von denen die Bodenfruchtbarkeit maßgeblich abhängt; ein unwiederbringlicher Verlust an Biodiversität geht mit der Entwaldung einher und die Auswirkungen auf den Kohlenstoffhaushalt der Erde sind enorm – gehen doch bereits heute schätzungsweise 12 bis 20 % der weltweit emittierten Treibhausgasemissionen auf das Konto der Tropenwaldvernichtung. Die klassischen Instrumente des Naturschutzes wie die Ausweisung von Schutzgebieten oder die Ausarbeitung internationaler Konventionen reichen offenbar für einen wirkungsvollen Schutz von Tropenwäldern nicht aus. Es sind neue Konzepte nötig, die die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung, die von der Nutzung der Wälder lebt, einbeziehen.
Organisator des Rundgesprächs: Prof. Dr. Reinhard MOSANDL
Mit Beiträgen von: Prof. Dr. Jörg BENDIX, Prof. Dr. Konrad FIEDLER, Prof. Dr. Robbert GRADSTEIN, Prof. Dr. Christoph KLEINN, Prof. Dr. Thomas KNOKE, Prof. Dr. Konrad MARTIN, Prof. Dr. Reinhard MOSANDL, Prof. Dr. Manfred NIEKISCH, Prof. Dr. Perdita POHLE, Prof. Dr. Josef H. REICHHOLF, Prof. Dr. Teja TSCHARNTKE und Prof. Dr. Michael WEBER.
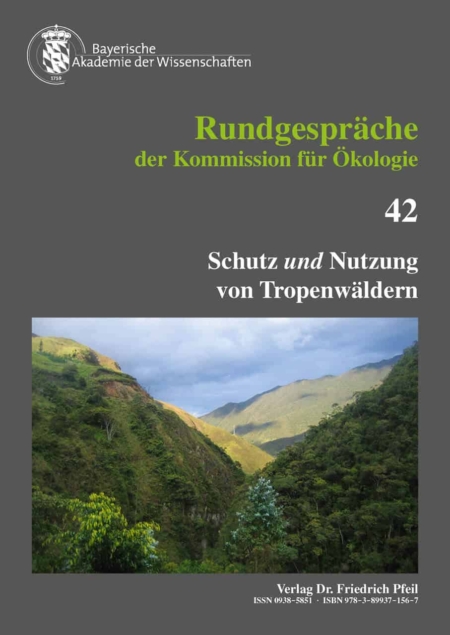
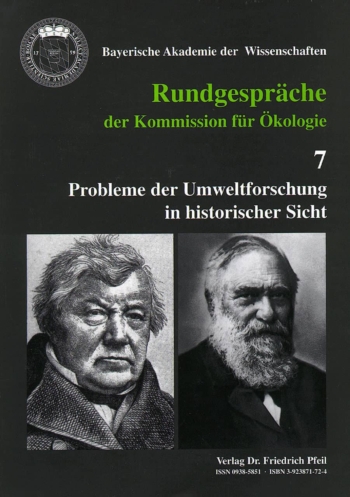
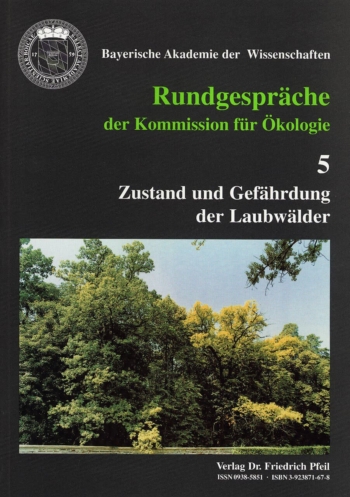
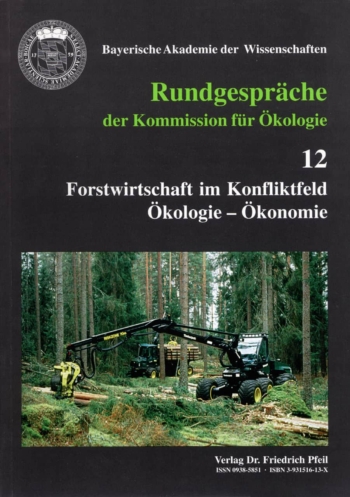
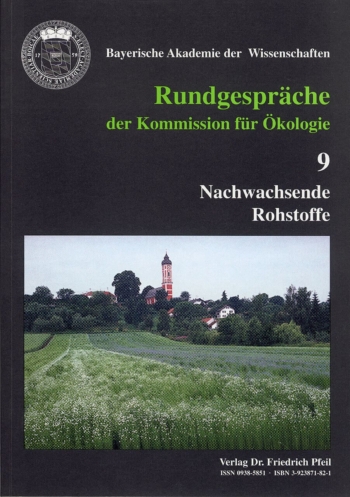
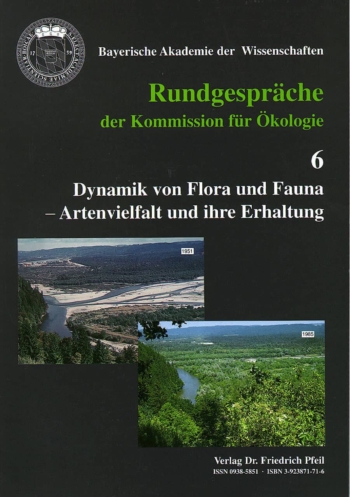
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.