Analyse stabiler Isotope hat sich in den letzten Jahren vor allem im Bereich der Biowissenschaften als eine äußerst vielseitige und gewinnbringende Methode etabliert, die wesentlich zum Verständnis der Prozesse und Wechselwirkungen innerhalb komplexer biologischer und ökologischer Systeme beigetragen hat. Viele sonst untrennbar ineinander verwobene Prozesse können inzwischen mithilfe der Analyse stabiler Isotope identifiziert und quantifiziert werden.
Der vorliegende Berichtband umfasst die Vorträge und Diskussionen einer gleichnamigen Fachtagung der Kommission für Ökologie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, ergänzt mit einer Zusammenfassung des Rundgesprächs. Er zeigt neben den Grundlagen anhand ausgewählter Beispiele die große Bedeutung und die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Analyse stabiler Isotope im ökologischen Bereich auf. Die praktische Anwendung reicht von Lebensmitteluntersuchungen bis hin zu Naturschutzempfehlungen; mithilfe der Analyse stabiler Isotope können das Klima der Vergangenheit rekonstruiert, die Eignung von Böden als Kohlenstoffspeicher bewertet oder der Einbau von Schwefeldünger in Kulturpflanzen verfolgt werden.
Organisation: Prof. Dr. Karl AUERSWALD, Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang HABER
Referenten: Karl AUERSWALD, Heiner FLESSA, Gerhard GEBAUER, Anette GIESEMANN, Peter HORN, Markus LEUENBERGER, Ulrich LÜTTGE, Andreas ROSSMANN, Hanns-Ludwig SCHMIDT, Hans SCHNYDER, Ulrich STRUCK
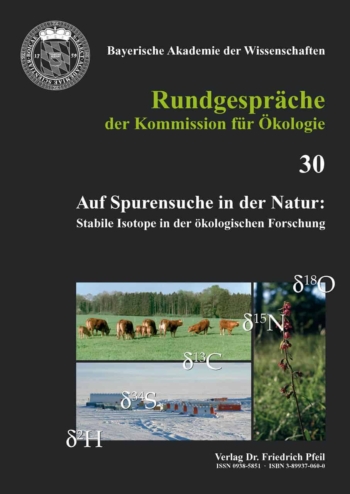
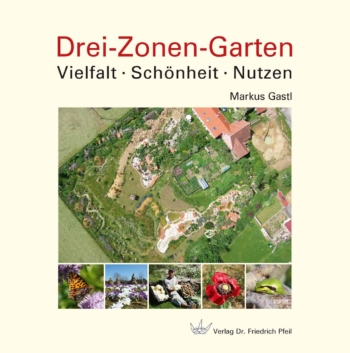
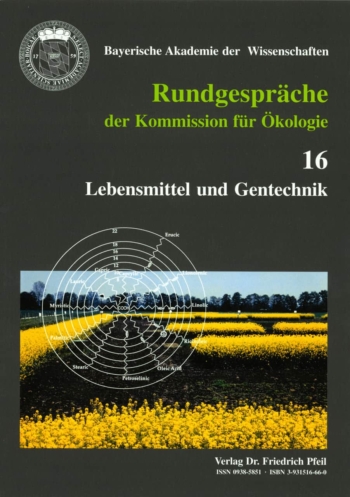
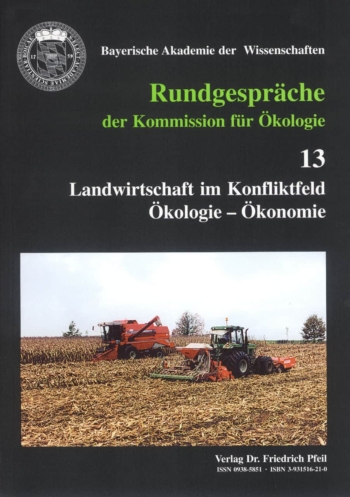
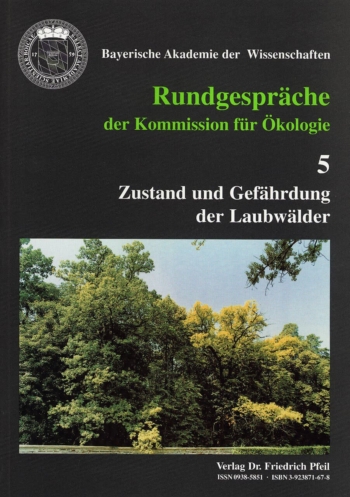
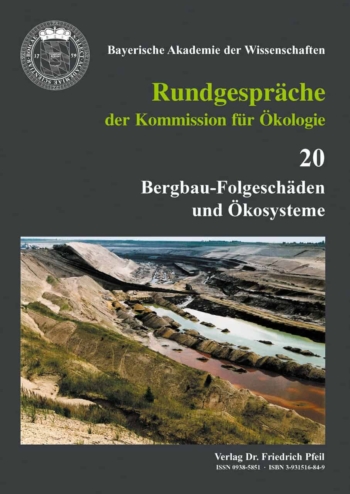
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.