Obwohl die Produktion von Wärme, Strom und Kraftstoffen aus erneuerbaren Energieträgern erst einen geringen Beitrag zur Gesamtenergiebereitstellung in Deutschland leistet, werden auf sie große Hoffnungen für die Zukunft gesetzt. Dabei leistet die Biomasse innerhalb der erneuerbaren Energieträger inzwischen den Hauptanteil an der Energiebereitstellung. Dazu gehören in erster Linie die Verwendung von Holz zur Wärmegewinnung, der Anbau und die Nutzung nachwachsender Rohstoffe wie Raps zur Herstellung von Biodiesel oder Mais zur Vergärung in Biogasanlagen, aber auch die Vergärung von Gülle zur Biogasproduktion, die Verwertung von Reststoffen, die z.B. bei Landschaftspflegemaßnahmen anfallen, oder von sonstigen Ernterückständen wie dem Halmgut von Getreide. Welche der zahlreichen Möglichkeiten zur Verwertung von Biomasse allerdings letztlich unter ökonomischen Gesichtspunkten sinnvoll sein werden, hängt entscheidend von den Preisen der fossilen Energieträger sowie von den politischen bzw. gesetzlichen Rahmenbedingungen ab.
Die derzeit schnelle Entwicklung auf dem Gebiet der Biomassenutzung weckt jedoch auch Befürchtungen. Die steigende Zahl bereits fertiggestellter, im Bau oder in der Planung befindlicher Anlagen zur Verarbeitung von Biomasse für die energetische Nutzung erfordert auch größere Anbauflächen, auf denen diese Biomasse heranwächst. Im Gespräch sind dabei zum Beispiel auch der Anbau von besonders hochwüchsigem Energiemais sowie die Anlage von Pappelplantagen zur Gewinnung von Hackschnitzeln. Befürchtet werden negative Folgen für Boden, Nährstoffhaushalt, Arten- und Biotopschutz, insbesondere, weil künftig auch bisher stillgelegte Flächen für die Erzeugung von Biomasse zur Energiebereitstellung in Anspruch genommen werden könnten, die einer artenreichen Fauna und Flora Lebensraum und Rückzugsmöglichkeiten bieten. Auch andere wichtige Funktionen wie die Trinkwasserbereitstellung, der Hochwasserschutz, die Jagd oder die Erholungsfunktion einer Landschaft können beeinträchtigt werden. Daneben steht der Anbau von Pflanzen zur energetischen Nutzung teilweise schon jetzt in Konkurrenz mit ihrer stofflichen Verwertung (Öl, Stärke, Zellulose, Fasern) und auch mit der Nahrungsmittelerzeugung.
Organisation: Prof. Dr. Gerhard FISCHBECK, Prof. Dr. Wolfgang HABER, Prof. Dr. Karl Eugen REHFUESS
Mit Beiträgen von: Martin FAULSTICH, Gerhard FISCHBECK, Axel GÖTTLEIN, Wolfgang HABER, Alois HEISSENHUBER, Michael RODE, Daniela THRÄN, Bernhard WIDMANN
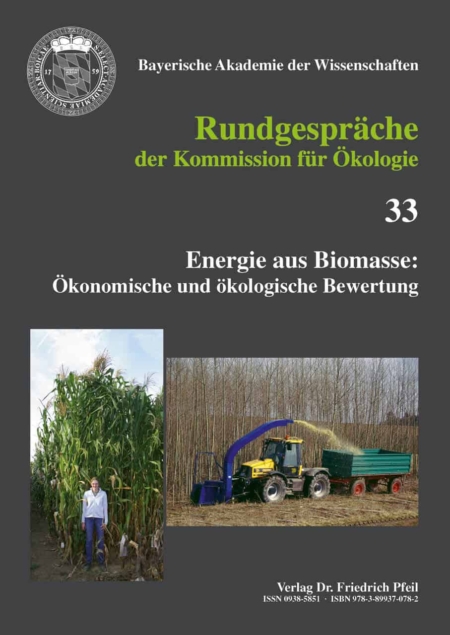
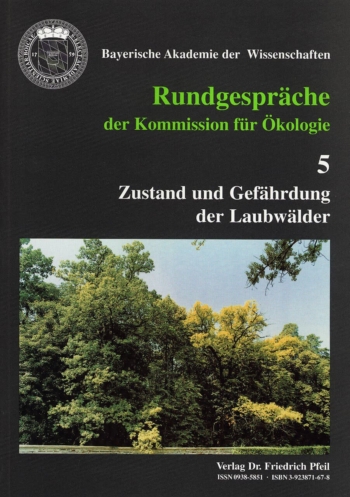
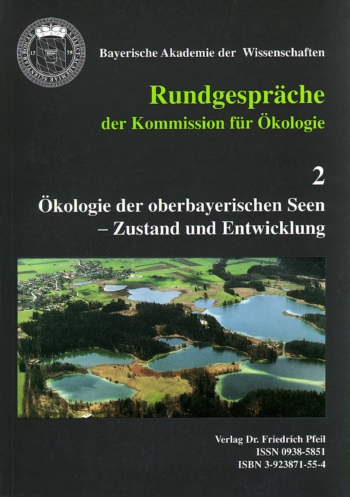
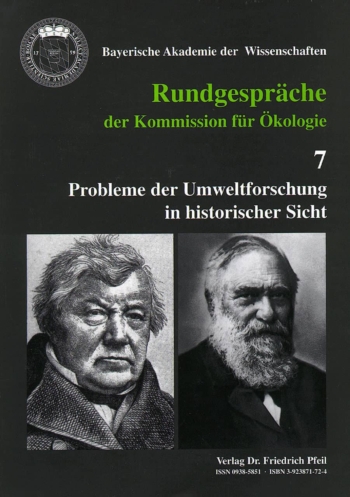
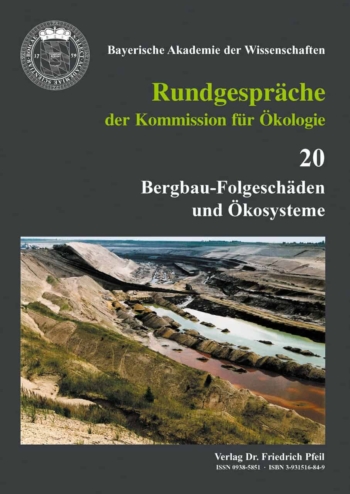
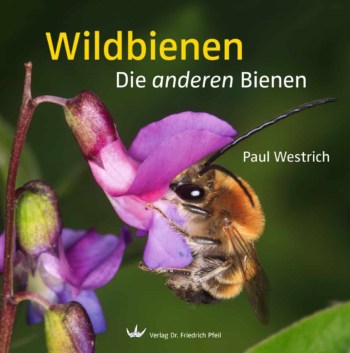
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.