Die Versorgung mit Energie ist die Basis unseres Wohlstands. Eine uneingeschränkte Nutzung fossiler Energieträger, ob zur Strom- und Wärmeerzeugung oder für die Mobilität, ist allerdings mit einem entsprechend hohen CO2-Ausstoß verbunden. Der Beschluss, alle deutschen Kernkraftwerke bis 2022 stillzulegen und Strom überwiegend aus erneuerbaren Energieträgern zu gewinnen, stellt enorme Herausforderungen nicht nur an Technik und Wirtschaft, sondern an uns alle. Es gilt, die Balance zwischen Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz bei hoher Zuverlässigkeit der Energieversorgung und ohne unverhältnismäßigen Anstieg der Energiepreise zu wahren.
Zu diesem komplexen Thema veranstaltete die Kommission für Ökologie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zusammen mit dem ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. im Januar 2012 eine Fachtagung, deren Inhalte nun nachgelesen werden können. Experten aus verschiedenen Bereichen beleuchten die Probleme unserer zukünftigen Energieversorgung aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Ökonomische und ökologische Aspekte bis hin zur Rolle Deutschlands beim globalen Klimaschutz werden behandelt, Nutzen und zukünftige finanzielle Belastungen aus dem Energiekonzept der Bundesregierung einander gegenübergestellt. Weitere wichtige Themen sind die Vorleistungen Deutschlands und der EU in der internationalen Staatengemeinschaft, die Reichweite fossiler Energieträger, die zeitlich und örtlich bedarfsgerechte Verfügbarkeit von Strom aus erneuerbaren Energieträgern sowie neue Entwicklungen im Gebäude- und Verkehrsbereich zur Steigerung der Energieeffizienz. Auch werden gesellschaftliche Fragen angesprochen, zum Beispiel der zunehmende Widerstand in der Bevölkerung gegen den Bau neuer Pumpspeicherkraftwerke oder dringend benötigter Hochspannungsleitungen.
Mit Beiträgen von: Dietrich BÖCKER, Wolfgang BUCHHOLZ, Hans-Peter EBERT, Ottmar EDENHOFER, Ulrich FAHL, Martin FAULSTICH, Peter FRITZ, Alois GLÜCK, Wolfgang HABER, Gerhard HAUSLADEN, Hans-Dieter KARL, Konrad KLEINKNECHT, Markus LIENKAMP, Franz MAYINGER, Karen PITTEL, Hans-Werner SINN, Hartmut SPLIETHOFF, Fritz VAHRENHOLT, Ulrich WAGNER, Joachim WEIMANN, Carl Christian VON WEIZSÄCKER und Dietrich H. WELTE. Mitwirkende der Podiumsdiskussion: Ottmar EDENHOFER, Hans-Werner SINN und Carl Christian VON WEIZSÄCKER, Moderation Klaus STRATMANN.
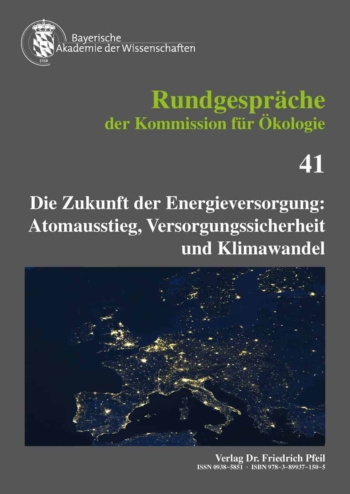
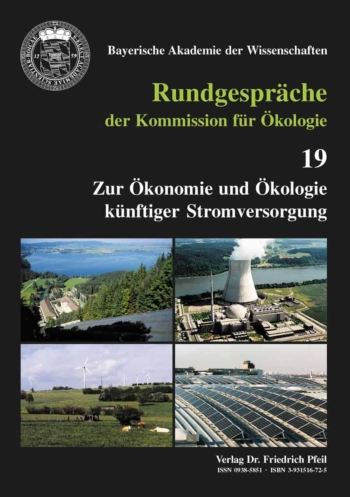
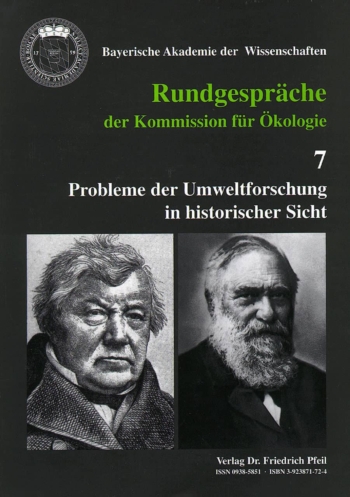
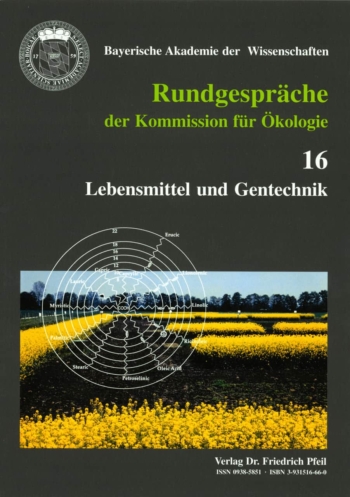
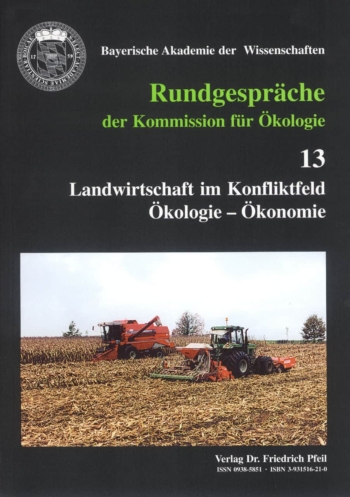
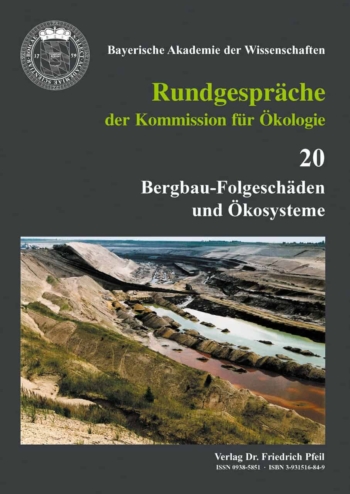
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.