In Staaten lebende Insekten (Ameisen und Termiten, soziale Bienen- und Wespenarten) gehören zu den heimlichen Herrschern unserer Erde. Sie spielen in nahezu jedem terrestrischen Ökosystem eine zentrale Rolle, sei es als Bestäuber von Blütenpflanzen, als Räuber kleiner Arthropoden oder indirekt als Pflanzen»fresser«, zum Beispiel durch die Haltung von Blattläusen oder die Symbiose mit Pilzen. Ihr enormer evolutionärer Erfolg beruht auf ihrer Staatenbildung: Soziale Insekten leben in Gruppen, die sich durch eine gut funktionierende Arbeitsteilung zwischen reproduktiven und nicht reproduktiven Individuen auszeichnen. Durch Kommunikation und Selbstorganisation schaffen es soziale Insekten trotz ihrer Kleinheit, riesige, komplexe Nester, Straßen oder Brücken zu bauen oder ergiebige Ressourcen effektiv zu nutzen. Dadurch beeinflussten sie über Jahrmillionen die Natur wesentlich.
Seit einigen Jahren häufen sich aber Negativnachrichten über soziale Insekten: Die Wildbienen sind bedroht und damit die Bestäubung nicht nur der Wildpflanzen, sondern auch unserer Kulturpflanzen. Ganze Honigbienenvölker sterben aus unbekannter Ursache aus. Im Mittelmeerraum breiten sich dagegen aus anderen Teilen der Welt eingeschleppte Ameisenarten mit großer Geschwindigkeit aus und verdrängen einheimische Arten. Die Gründe für diese Entwicklungen sind vielfältig, unter anderem spielen Klimaveränderung, die Intensivierung der Landnutzung und die fortschreitende Globalisierung von Flora und Fauna eine Rolle.
Organisatoren des Rundgesprächs: Prof. Dr. Jürgen HEINZE, Prof. Dr. Andreas BRESINSK
Mit Beiträgen von: Prof. Dr. Manfred AYASSE, Prof. Dr. Nico BLÜTHGEN, Prof. Dr. Sylvia CREMER, Prof. Dr. Susanne FOITZIK, Prof. Dr. Jürgen HEINZE, Prof. Dr. Judith KORB, Prof. Dr. Randolf MENZEL, Prof. Dr. Robin F. MORITZ, Prof. Dr. Flavio ROCES, Prof. Dr., Ingolf STEFFAN-DEWENTER, Priv.-Doz. Dr. Volker WITTE.
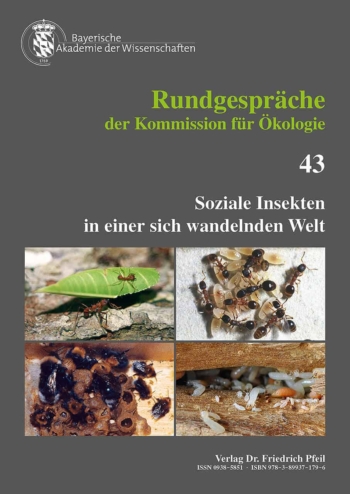
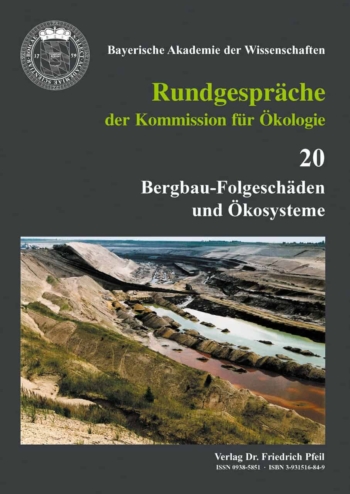
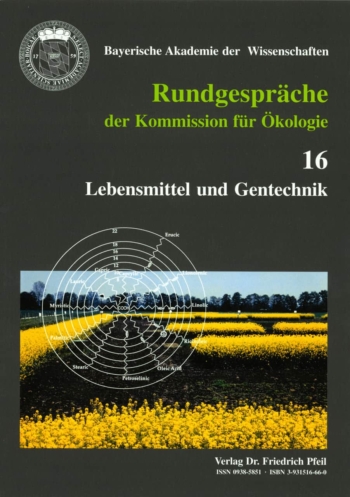
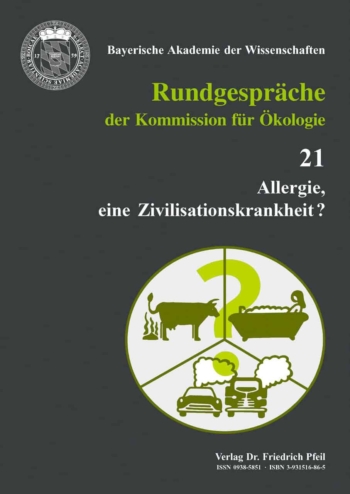
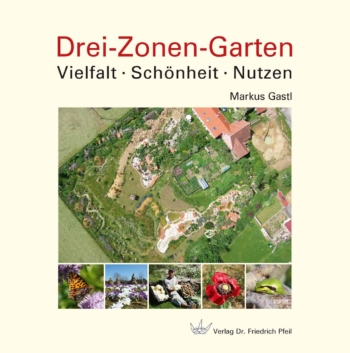
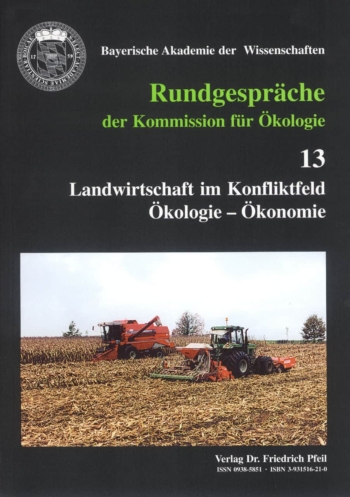
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.