Durch Tiere auf den Menschen übertragene Infektionskrankheiten, so genannte Zoonosen, sind in den letzten Jahren verstärkt in den Blickpunkt des Interesses gerückt. Zwar sind die zugrunde liegenden biologischen Systeme aus Wirtstier (z.B. Fuchs, Igel, Hund, Katze) und von diesem auf den Menschen übertragenen Parasiten (z.B. infizierte Zecke, Fuchsbandwurm) meist seit langem bekannt und es liegen von medizinischer Seite viele Daten z.B. über die Häufigkeit und die geografische Ausbreitung der Krankheiten vor. Es fehlen aber oft neuere Untersuchungen zur Ökologie und zur Verbreitung der Wirtstiere, z.B. zu möglicherweise verändertem Fress-, Jagd- oder Brutverhalten aufgrund von in den letzten Jahren oder Jahrzehnten veränderten Umweltbedingungen. Sofern derartige ökologische Daten vorhanden sind, fehlt zudem oft ihre Verknüpfung mit den entsprechenden medizinisch-epidemiologischen Daten.
Die Brücke zwischen Medizin und Epidemiologie einerseits und Ökologie andererseits zu schlagen, war Ziel des Rundgesprächs »Zur Ökologie von Infektionskrankheiten: Borreliose, FSME und Fuchsbandwurm«. Aus der Fülle der weltweit für den Menschen bedeutenden Zoonosen wurden dabei exemplarisch die Übertragung des Malaria-Erregers durch die Anopheles-Mücke, die Übertragung des Fuchsbandwurms sowie die Übertragung von Zecken mit Borreliose- oder FSME-Erregern durch Füchse und andere frei lebende Tiere behandelt.
Organisation: Prof. Dr. Erika von MUTIUS, Prof. Dr. Josef H. REICHHOLF
Referenten: Erika VON MUTIUS, Thomas LÖSCHER, Volker FINGERLE, Gerhard DOBLER, Annette POHL-KOPPE, Hans Hubert GERARDS, Andreas KÖNIG, Dirk VAN DER SANT, Josef H. REICHHOLF
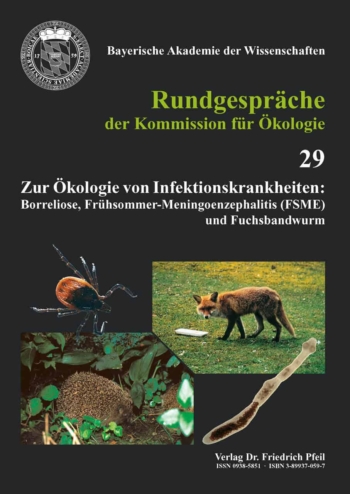
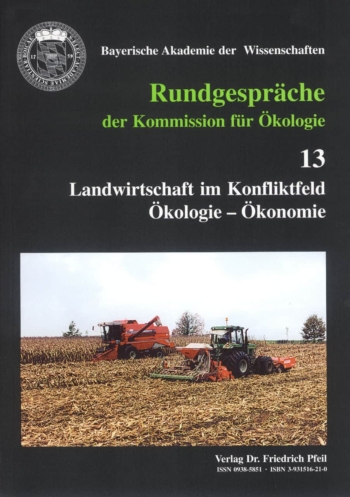
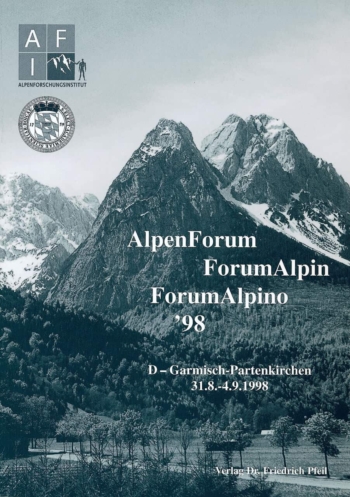
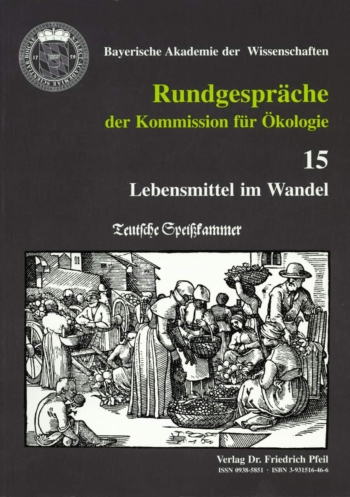
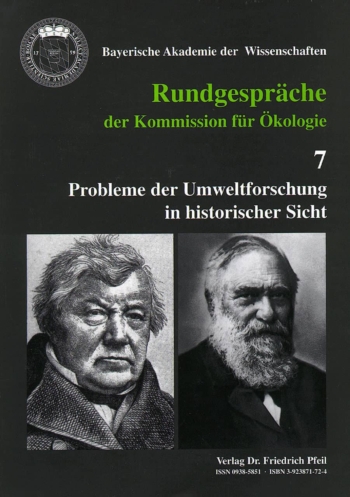
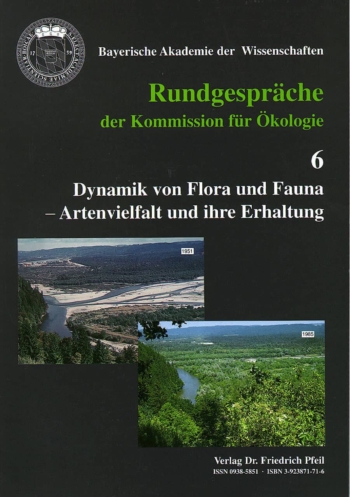
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.