In den letzten 50 Jahren ist der Naturschutz, und hier insbesondere der Artenschutz, zunehmend in der Gesetzgebung verankert worden. Trotz aller Schutzanstrengungen nimmt die Zahl der gefährdeten oder vom Aussterben bedrohten Pflanzen- und Tierarten jedoch weiter zu. Warum ist dies so? Gibt es Schwachstellen in der Gesetzgebung oder in der Praxis? Wo liegen die Gründe für gescheiterte oder uneffektive Maßnahmen? Welche Rolle spielt der Naturschutz, wenn eine Art wieder häufiger wird?
Ausgehend von diesen Fragen beleuchtet das vorliegende Buch die Rolle der Wissenschaft für den Naturschutz. Es will aufzeigen, wo Forschungslücken bestehen, wie Artenschutz- und Naturschutzmaßnahmen wissenschaftlich besser als bisher begleitet werden können und wie der Informationsaustausch zwischen Wissenschaft und der Naturschutzpraxis in den zuständigen Fachbehörden verbessert werden kann. Darüber hinaus werden wissenschaftliche Methoden zur Findung von Schlüsselfaktoren für bedrohte Arten und eine biogeografische Analyse der heute in Deutschland am strengsten geschützten Arten vorgestellt. Eine Betrachtung der historischen Entwicklung des Naturschutzes in Deutschland und ein Beitrag zur Entscheidungsfindung im Naturschutz in Australien runden das Thema ab.
Organisator des Rundgesprächs: Prof. Dr. Wolfgang W. WEISSER
Mit Beiträgen von: Prof. Dr. Heike FELDHAAR, Prof. Dr. Jürgen GEIST, Dr. David GIBBONS, Priv.-Doz. Dr. Jan Christian HABEL, Prof. Dr. Wolfgang HABER, Prof. Dr. Johannes KOLLMANN, Prof. Dr. Hugh POSSINGHAM, Prof. Dr. Josef H. REICHHOLF, Prof. Dr. Wolfgang W. WEISSER, Dr. Willy ZAHLHEIMER.
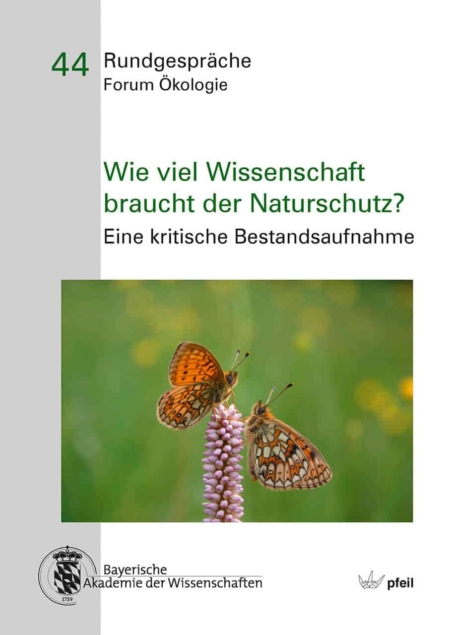
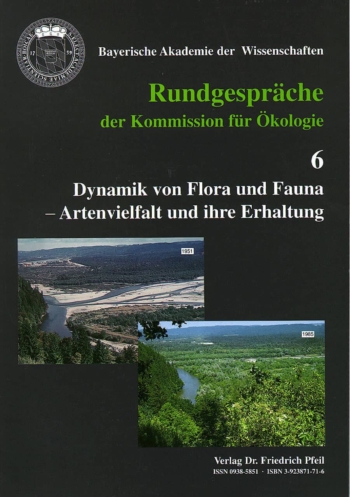
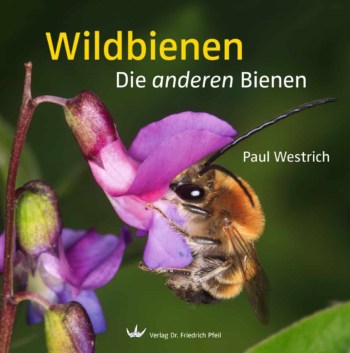
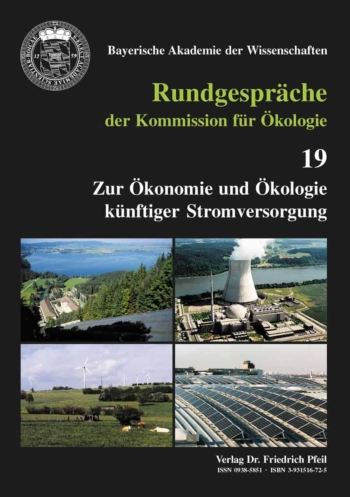
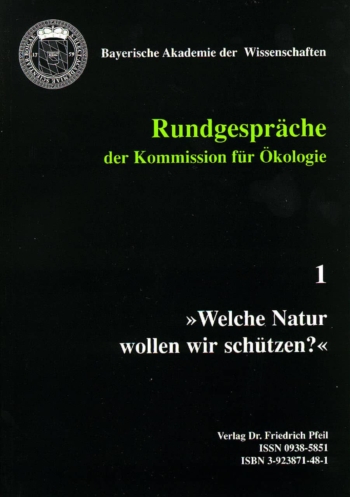
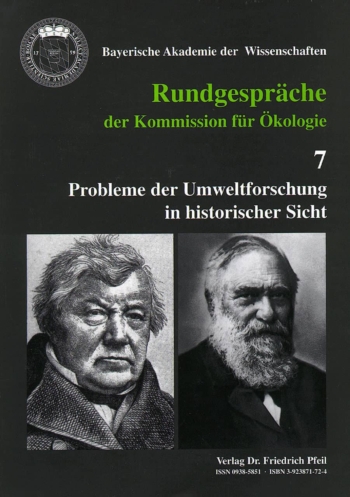
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.