Die Jagd begleitet den Homo sapiens von Beginn seiner Geschichte. Mit zeitlich wechselndem Gewicht dient sie u.a. dem Nahrungserwerb, der Abwehr der von wild lebenden Tieren drohenden Gefahren, der Befriedigung von Jagdlust, Beutegier und Prestigebedürfnis sowie als Status- und Machtsymbol. Sie hat darüber hinaus gerade heute auch wichtige ökologische Funktionen; denn Jäger wirken direkt und indirekt bei der Regulation von Wildtierpopulationen mit und helfen beim Artenschutz. Ein kompliziertes Regelwerk aus Jagd-, Naturschutz- und Tierschutzgesetzen steuert heute einerseits die Ausübung der Jagd selbst. Es sucht andererseits einen Ausgleich zwischen den Wildtierbeständen und der Tragfähigkeit ihrer Lebensräume, zwischen den häufig konträren Interessen der Jagd/Jäger und anderer Zweige der Bodennutzung und des Naturschutzes sowie zwischen den individuellen Ansprüchen der Jäger und den gesellschaftlichen Belangen. Die derzeitige intensive Diskussion über die Novellierung des Bundesjagdgesetzes wirft darauf ein Schlaglicht.
Organisation: Prof. Dr. Dieter FREY, Prof. Dr. Karl-Eugen REHFUESS
Referenten: Karl-Eugen REHFUESS, Sigrid SCHWENK, Dieter LAUVEN, Bernhard SCHÜTZ, Christiane UNDERBERG, Klaus Albert STRUNK, Franz BROSINGER, Josef H. REICHHOLF, Paul MÜLLER, Karl Friedrich SINNER, Reinhard STROBL, Jürgen VOCKE
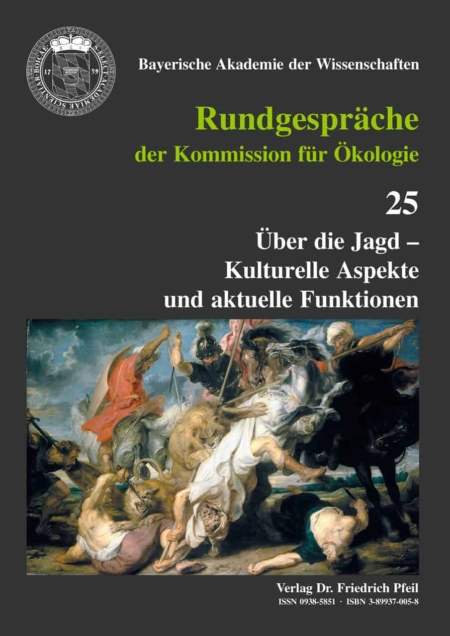
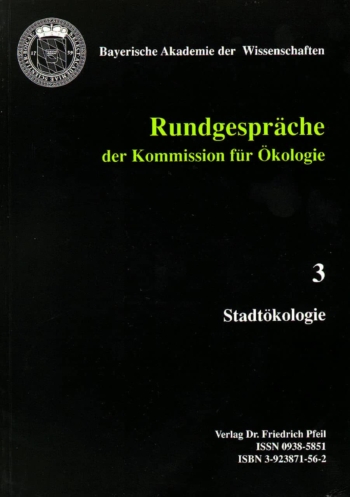
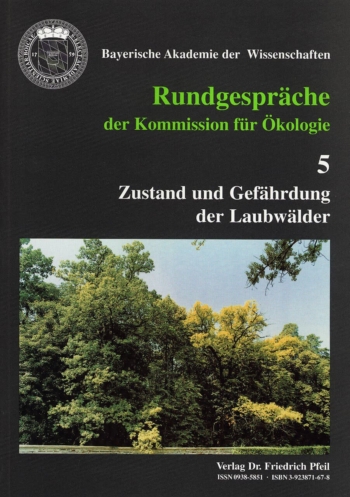
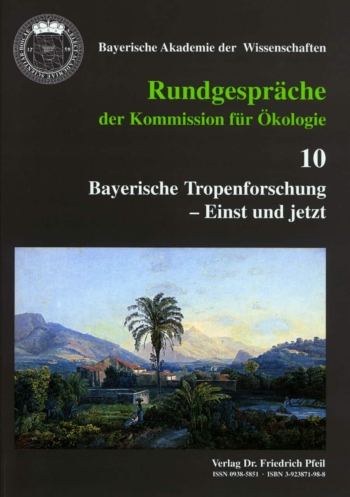
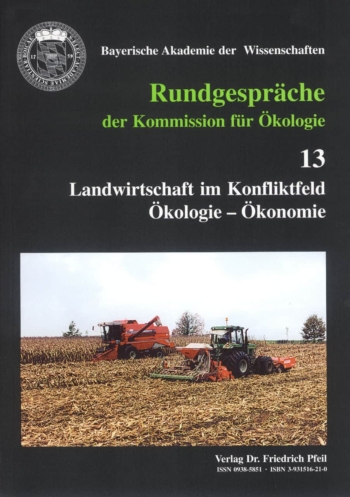
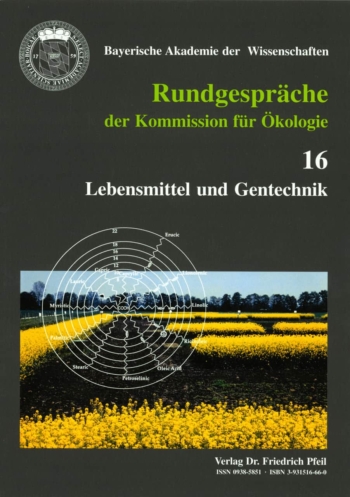
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.