Pilze spielen in den unterschiedlichsten Ökosystemen eine tragende Rolle. Sie leben heterotroph und nutzen dabei verschiedene Ernährungsstrategien. Als Mykorrhizapilze sind sie wichtige Lebenspartner nicht nur unserer Waldbaumarten, sondern beispielsweise auch der wichtigsten Kulturpflanzen. Diese Wurzelsymbiose trug in der Erdgeschichte wesentlich zu der umfassenden und erfolgreichen Landnahme durch Pflanzen bei. Als Saprobionten zersetzen Pilze tote organische Materie wie Zellulose und Lignin. Ohne diese Abbauleistungen würde die Biosphäre am »Biomüll« ersticken. Mit ihrem Stoffwechsel sorgen Pilze aber nicht nur für den Abbau, sondern auch für die Synthese einer sehr großen Zahl verschiedenartigster Verbindungen, die ökologisch bedeutsam sind und vom Menschen in vielfältiger Weise genutzt werden können. Andererseits verursachen Pilze als Parasiten Schäden von erheblicher volkswirtschaftlicher Bedeutung, indem sie andere Lebewesen – Pflanzen, Tiere und den Menschen – befallen. In dem vorliegenden Berichtsband werden verschiedene Aspekte dieser Zusammenhänge beleuchtet, ergänzt durch Beiträge über die Evolution von Basidiomyceten, über die modernen Aufgaben wissenschaftlicher Sammlungen und über die Zukunft der Mykologie in Deutschland.
Der Band enthält die überarbeiteten Vorträge und Diskussionen einer gleichnamigen Fachtagung der Kommission für Ökologie sowie eine taxonomische Liste und ein Schlagwortverzeichnis. Er richtet sich nicht nur an Fachleute, sondern an alle am Umweltgeschehen interessierten Leser.
Das Thema dieses Rundgesprächs lag dem langjährigen Vorsitzenden der Kommission für Ökologie, Herrn Professor Hubert Ziegler, der kurz nach der Tagung verstorben ist, sehr am Herzen. Ein Nachruf soll an ihn erinnern.
Organisation: Prof. em. Dr. Andreas BRESINSKY und Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Hubert ZIEGLER†
Mit Beiträgen von: Reinhard AGERER, Andreas BRESINSKY, Michael FISCHER, Martin HOFRICHTER, Ralph HÜCKELHOVEN, Franz OBERWINKLER, Wolfgang OSSWALD, Karin PRITSCH, Arthur SCHÜSSLER, Peter SPITELLER, Wolfgang STEGLICH und Dagmar TRIEBEL.
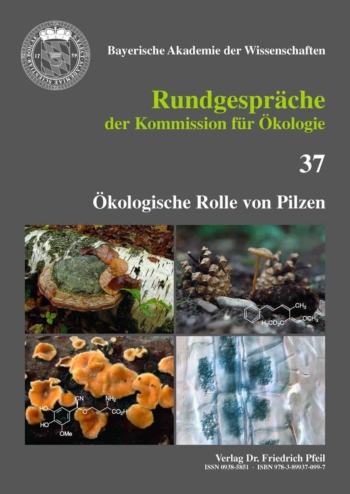
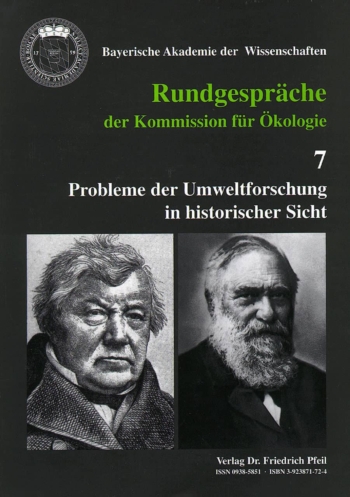
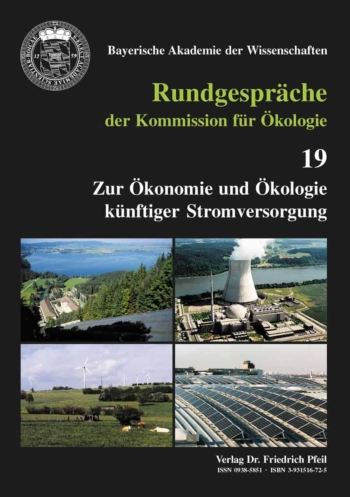
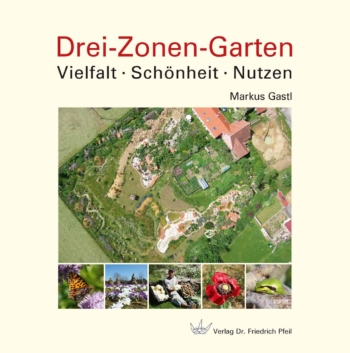
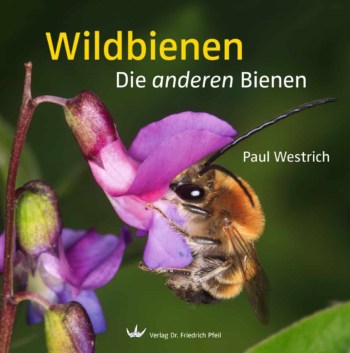
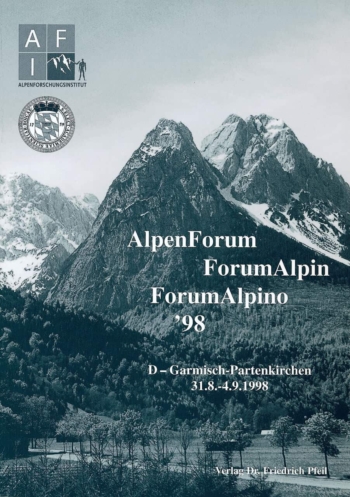
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.