Noch nie war einer der Berichtbände der Kommission für Ökologie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften so aktuell wie der vor kurzem erschienene Band 24 mit dem Titel »Katastrophe oder Chance? Hochwasser und Ökologie« – auch wenn die neuesten Daten von dem Sommerhochwasser 2002 noch nicht ausgewertet und daher auch noch nicht in dem Buch enthalten sind.
Der Grundgedanke des gleichnamigen Rundgesprächs der Kommission für Ökologie im Herbst 2001 war, auch einmal die »andere Seite« von Hochwässern aufzuzeigen: Während für Menschen, die die flussnahen Bereiche als Siedlungsgebiete oder landwirtschaftlich nutzen, Hochwässer ein enormes Gefährdungspotenzial darstellen – wie die katastrophalen Ereignisse vom Sommer 2002 an Donau und Elbe und ihren Nebenflüssen gezeigt haben –, sind flussnahe Auenlandschaften in ihrer Ökologie auf regelmäßige Überschwemmungen und Hochwässer angewiesen. Für die Fauna und Flora dieser Ökosysteme kann Hochwasser durchaus eine »Chance« bedeuten. Die Zerstörung dieser Auenlandschaften und damit natürlicher Retentionsräume in den vergangenen Jahrzehnten hat die Hochwässer vielerorts noch verstärkt. Aber wie soll heute ein Hochwasserschutz aussehen, der beiden Aspekten, d.h. sowohl der Ökologie flussnaher Landschaften als auch den Gefährdungen und Ängsten der dort lebenden Menschen gerecht wird?
Das nun vorliegende Buch nähert sich diesem vielseitigen und ökologisch so wichtigen Spannungsfeld von ganz verschiedenen Seiten. In 11 Vorträgen werden die unterschiedlichsten Fragenkomplexe behandelt; die an die einzelnen Kapitel anschließenden Diskussionen sowie die Abschlussdiskussion spiegeln dabei die oft unterschiedlichen Expertenmeinungen zu den Themen wider.
Organisation: Prof. Dr. Dr. h.c. Horst HAGEDORN
Referenten: Horst HAGEDORN, Rüdiger GLASER, Ulrich EBEL, Klement TOCKNER, Ludwig BRAUN, Karl AUERSWALD, Franz VALENTIN, Ulrike PFARR, Hermann JERZ, Jens AMENDT, Peter JÜRGING, Josef H. REICHHOLF
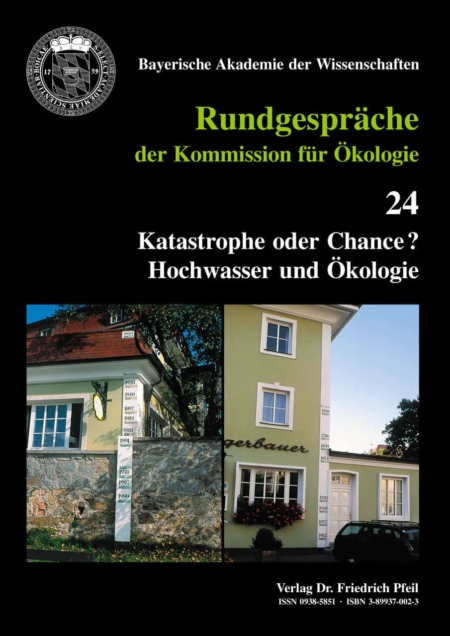
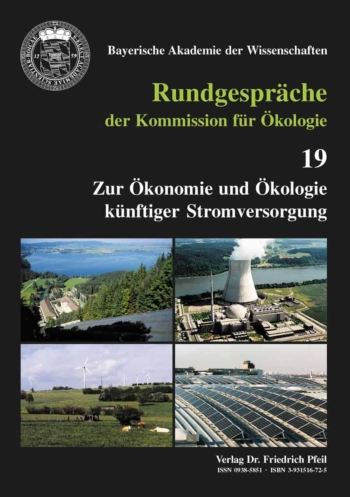
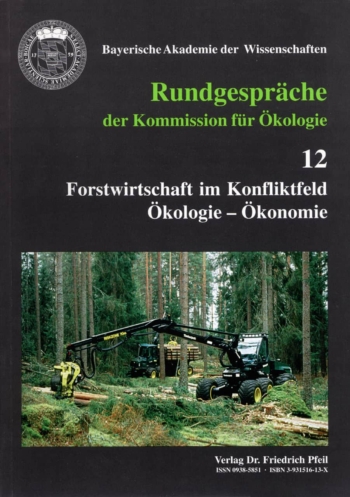
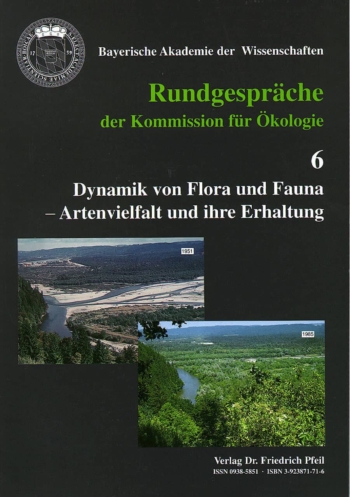
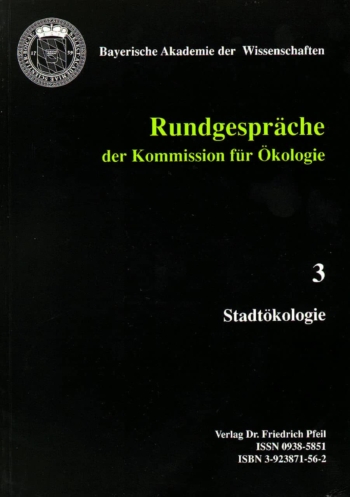
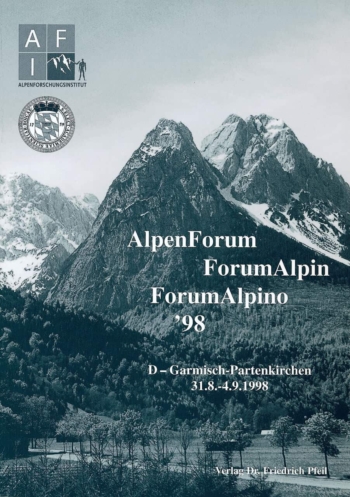
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.