Alle Organismen benutzen in irgendeiner Weise Moleküle als Signale, um Information auszutauschen. Diese »chemischen Sprachen« sind die älteste Form der Kommunikation in der Natur. Die Chemische Ökologie als eigenständige interdisziplinäre Forschungsrichtung befasst sich unter anderem mit der Identifizierung dieser Signale, mit der Aufklärung von Systemen zu ihrer Wahrnehmung und Weiterleitung in die Zelle bzw. in den Organismus, aber auch mit den Wirkungen der Signale auf die Evolution, das Verhalten und die Ökologie der beteiligten Organismen. Das vorliegende Buch gewährt neue und überraschende Ergebnisse aus diesem faszinierenden Forschungsfeld.
Die einzelnen Kapitel stellen spannende Beispiele chemischer Kommunikation vor, sowohl hinsichtlich der Vielfalt der Lebewesen – über Höhere Pflanzen, Grünalgen, Insekten, Schwämme, Pilze und Bakterien wird berichtet – als auch der Vielfalt der Interaktionen, die durch chemische Stoffe vermittelt werden, vom symbiontischen Zusammenleben bis zur komplexen Abwehr von Fraßfeinden. Darüber hinaus werden wichtige Methoden vorgestellt, die heute in der Chemischen Ökologie eine Rolle spielen.
Der Band enthält die überarbeiteten Vorträge und Diskussionen einer gleichnamigen Fachtagung, ergänzt mit einem Schlagwort- und einem Artenverzeichnis. Er richtet sich gleichermaßen an Fachleute wie an interessierte Laien.
Organisator des Rundgesprächs: Prof. Dr. Markus RIEDERER
Mit Beiträgen von: Prof. Dr. Ute HENTSCHEL HUMEIDA, Dr. Ulrich HILDEBRANDT, Prof. Dr. Monika HILKER, Prof. Dr. Kirsten JUNG, Prof. Dr. Erika KOTHE, Priv.-Doz. Dr. Axel MITHÖFER, Prof. Dr. Caroline MÜLLER, Prof. Dr. Martin PARNISKE, Prof. Dr. Markus RIEDERER, Prof. Dr. Joachim RUTHER und Dr. Thomas WICHARD.
Organisatoren:
Prof. Dr. med.vet. Johann Bauer
Prof. Dr. med. Erika von Mutius
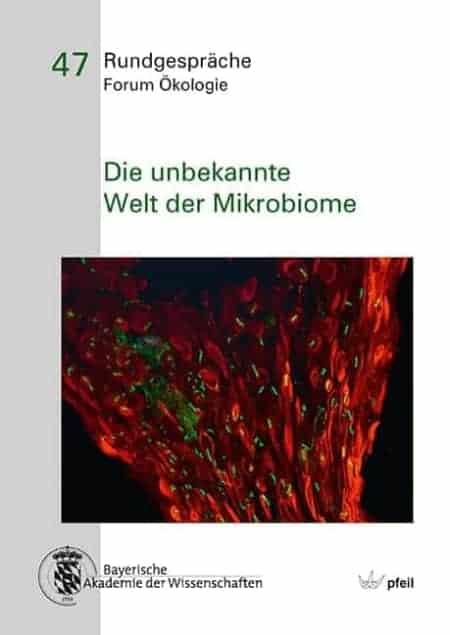
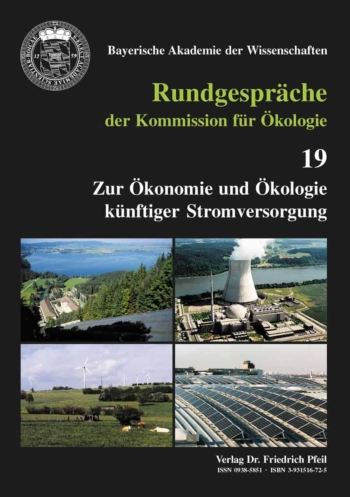
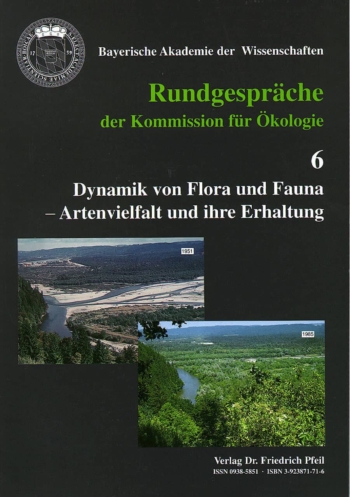
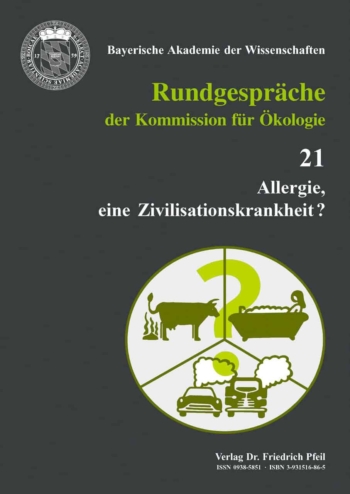
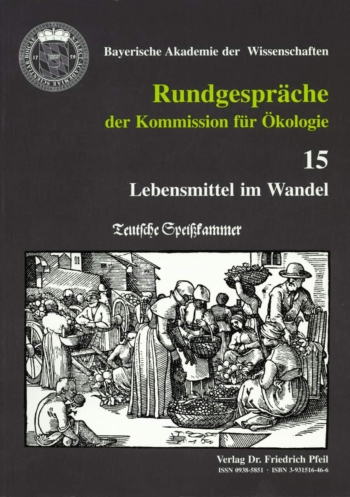
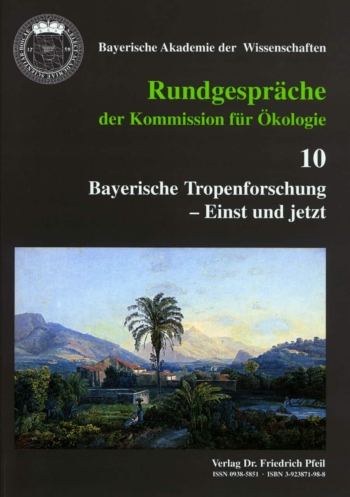
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.