Schon seit Jahren ist in den westlichen Ländern ein beunruhigender Anstieg allergischer Erkrankungen zu beobachten. In Deutschland sollen nahezu ein Drittel aller Schulkinder betroffen sein. Darüber gibt es viele Hypothesen oder Erklärungsversuche, wobei gerade in der letzten Zeit Gesichtspunkte des Lebensstils verstärkt von Fachleuten diskutiert werden. In diese Richtung weisen z.B. Vergleiche von Kindern in Leipzig und München, die unmittelbar nach Öffnung der innerdeutschen Grenze begonnen wurden, oder Vergleiche von Kindern aus ländlicher Umgebung, die, im selben Dorf lebend, auf einem Bauernhof bzw. ohne Berührung mit der Landwirtschaft aufwachsen. Es scheint sich abzuzeichnen, dass der frühkindlichen Stimulierung des Immunsystems eine wichtige Rolle im späteren Allergiegeschehen zukommt.
Die Hintergründe und Fragestellungen dieser spannenden Thematik beleuchtet das vorliegende Buch mit dem bewusst provokant gewählten Titel »Allergie, eine Zivilisationskrankheit?«. Von führenden Wissenschaftlern vorgestellt und diskutiert werden in dem Buch die Rolle der von außen auf uns einwirkenden möglichen Allergieauslöser, wie etwa Nahrungsmittel, Pollen, Milben oder Luftschadstoffe, die Bedeutung von Lebensstilfaktoren, wie etwa Familiengröße oder der Kontakt zu Stalltieren, als auch der mögliche Einfluss psychologischer Faktoren auf das Allergiegeschehen. Der besondere Reiz dieses Buches liegt daher im vielfältigen Gespräch von Vertretern z.B. der Immunologie, der Epidemiologie, der klinischen Disziplinen, der Arbeitsmedizin und der Psychologie.
Organisation: Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus BETKE, Priv.-Doz. Dr. Erika von MUTIUS
Referenten: Klaus BETKE, Charlotte BRAUN-FAHRLÄNDER, Joachim HEINRICH, Joachim KÜHR, Erika von MUTIUS, Dennis NOWAK, Harald RENZ, Rainer RICHTER, Johannes RING, Ulrich WAHN, Hubert ZIEGLER
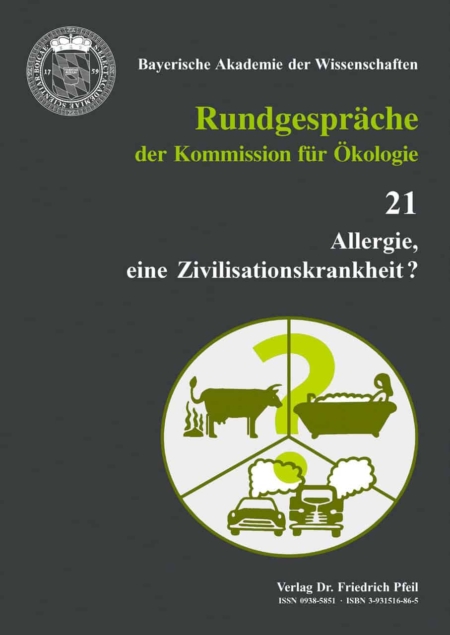
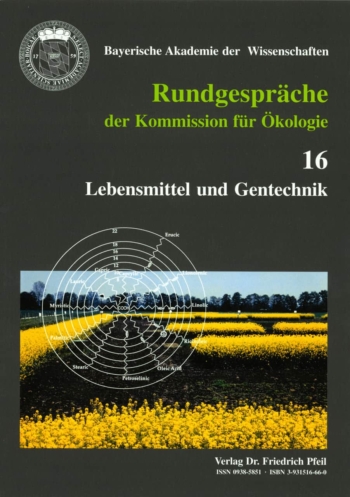
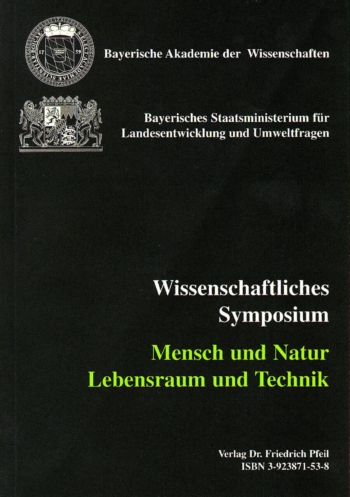
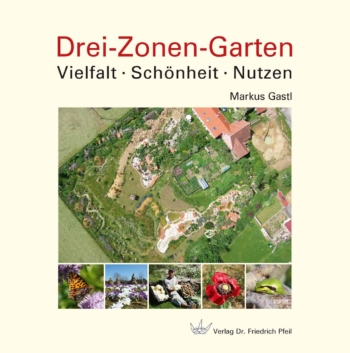
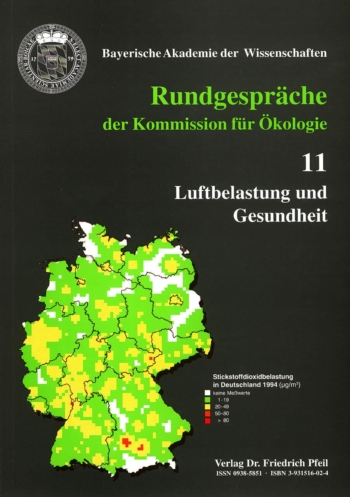
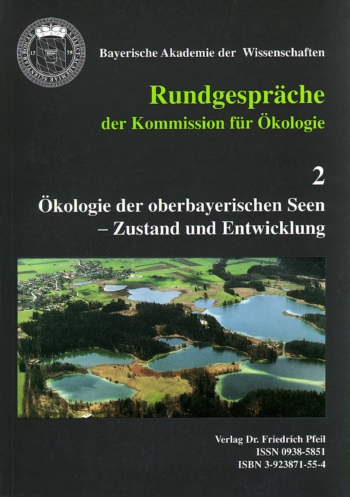
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.