Die derzeit beobachteten Umweltveränderungen (Klima, Landnutzung, Ressourcenschwund, Verstädterung, Demografie) werden in ihren Auswirkungen unterschiedlich diskutiert und bewertet. Prognosen erweisen sich als schwierig und unsicher. Als Bezugs- und Bewertungsgrundlage, besonders im Hinblick auf die Landnutzung, die Pflanzen- und die Tierwelt, dient in der Regel die jüngere Vergangenheit des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Doch diese war selbst eine »Übergangszeit« mit raschen Veränderungen und keineswegs so »stabil«, dass sie eine verlässliche Grundlage für heutige Entscheidungen über die Umweltentwicklung abgeben könnte.
Der Rückblick auf das ganze letzte Jahrtausend, vom Hochmittelalter bis in die Gegenwart, soll daher der Frage nachgehen, wie stabil oder veränderlich denn die Zeiten waren, aus denen unsere Gegenwart entstanden ist: Was änderte sich in Landschaft und Landnutzung, in der Pflanzen- und Tierwelt in Mitteleuropa? Inwieweit waren diese Veränderungen klimatisch bedingt? Und wie wirkten sich die Klimaveränderungen wiederum auf die Realgeschichte aus? Dabei wird die vom Thema vorgegebene örtliche (Mitteleuropa) und zeitliche (letztes Jahrtausend) Begrenzung in einigen Beiträgen bewusst ausgeweitet, um auch diese 1000 Jahre in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Erst wenn wir wissen, unter welchen Voraussetzungen sich unsere heutige »Umwelt« gebildet hat, wie sich die Natur- zur Kulturlandschaft gewandelt und sich die Tier- und Pflanzenwelt verändert hat, können wir die Vorgänge in der Gegenwart richtig einschätzen und für die Zukunft Prognosen wagen.
Organisation: Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang HABER, Prof. Dr. Josef H. REICHHOLF
Mit Beiträgen von: Ehrentraud BAYER, Kurt BRUNNER, Imanuel GEISS, Wolfgang HABER, Bernd HERRMANN, Ragnar KINZELBACH, Hansjörg KÜSTER, Reinhard MOSANDL, Josef H. REICHHOLF
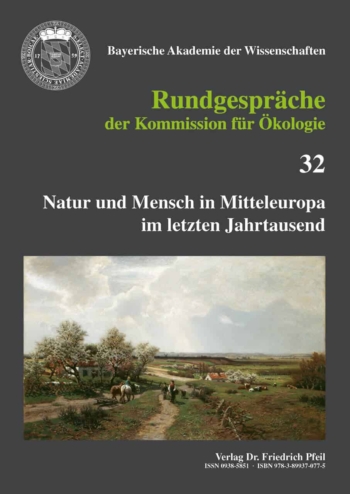
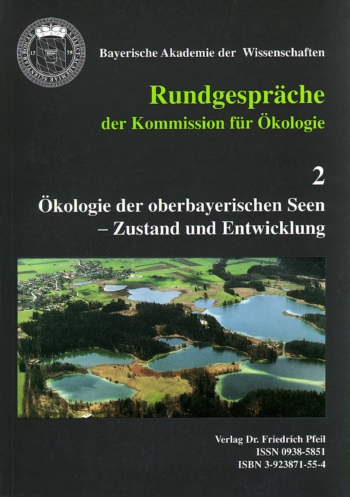
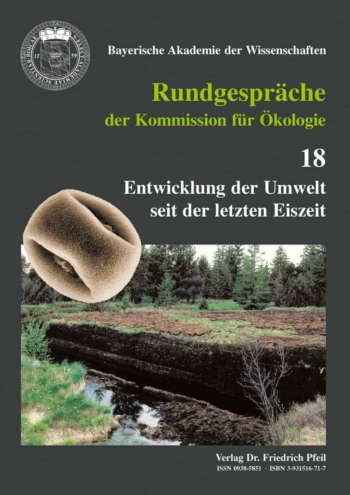
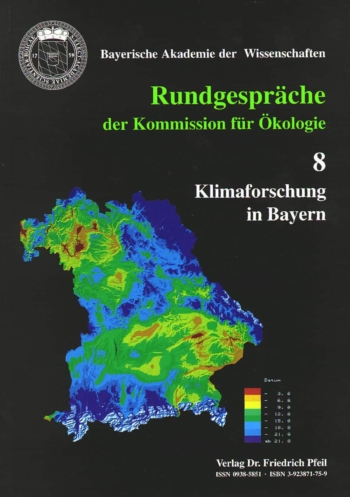
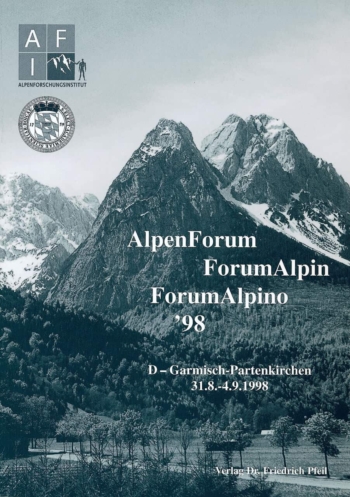
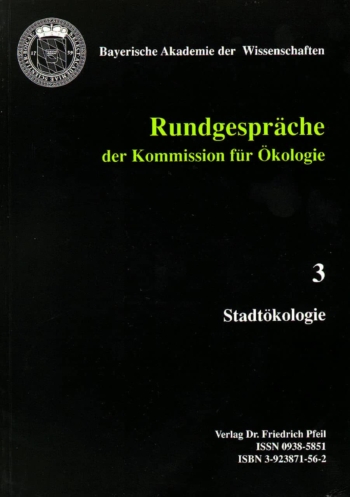
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.