Gebietsfremde, mit oder ohne menschliches Zutun eingewanderte Tier- oder Pflanzenarten – sind sie willkommene Bereicherung oder gefährliche Konkurrenz für die einheimischen Arten? Aber wie ist dieses »einheimisch« eigentlich definiert? Was Manche für eine Bedrohung halten, wie z.B. den Riesenbärenklau, ist nach dem Naturschutzgesetz längst heimisch. Andererseits können durch die sog. Neozoen oder Neophyten immense wirtschaftliche Schäden entstehen, die es rechtzeitig abzuschätzen und zu verhindern gilt. Von den 12000 Gefäßpflanzen, die seit der Entdeckung Amerikas 1492 nach Mitteleuropa kamen, konnten sich nur 417 (3,5 %) dauerhaft etablieren und davon wiederum sind nur ca. 20 unerwünscht und werden spezifisch bekämpft. Was spielt sich im Ökosystem wirklich ab, wenn sich gebietsfremde Arten etablieren und ausbreiten? Lassen sich möglicher Erfolg oder wahrscheinliches Scheitern von Neophyten und Neozoen aufgrund der bisherigen Kenntnisse vorhersagen?
Aus der Fülle wissenschaftlicher Grundlagen und Modellen zur Frage nach der Einwanderung, Anpassung, Ausbreitung und dem Aussterben von Arten stellt der vorliegende Berichtband ausgewählte Beispiele vor. Zahlreiche, z.T. farbige Abbildungen veranschaulichen die Texte, die Diskussionen geben zusätzlichen Einblick in die aktuelle wissenschaftliche Meinungsvielfalt.
Organisation: Prof. Dr. Josef H. REICHHOLF
Referenten: Harald AUGE, Roland BRANDL, Wolfgang HABER, Karl HURLE, Ragnar KINZELBACH, Stefan KLOTZ, Ingo KOWARIK, Josef H. REICHHOLF, Thomas TITTITZER, Ludwig TREPL
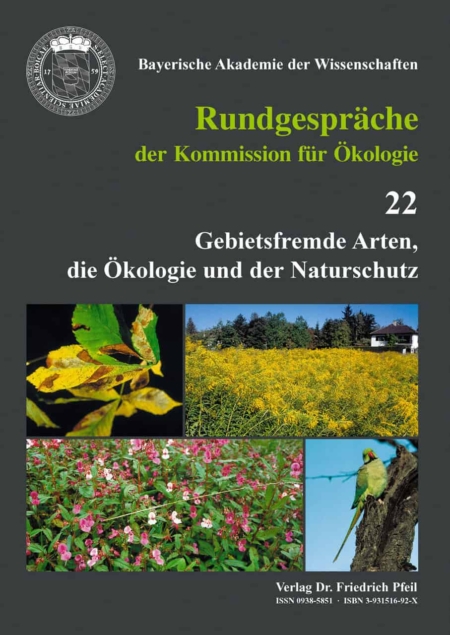
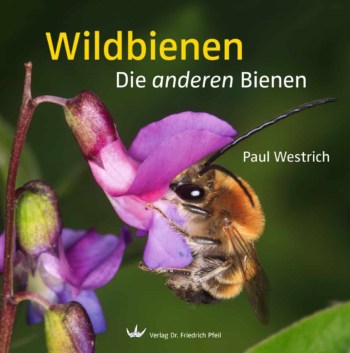
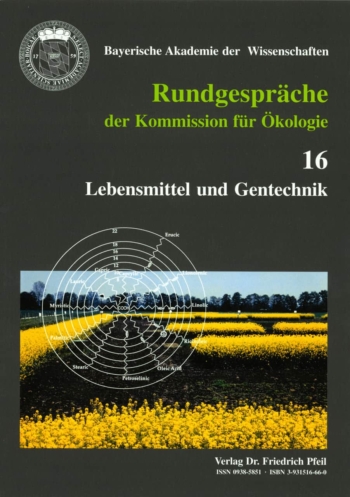
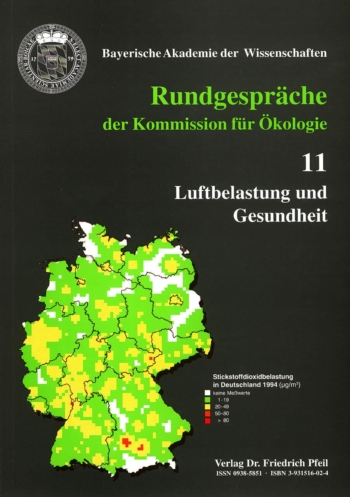
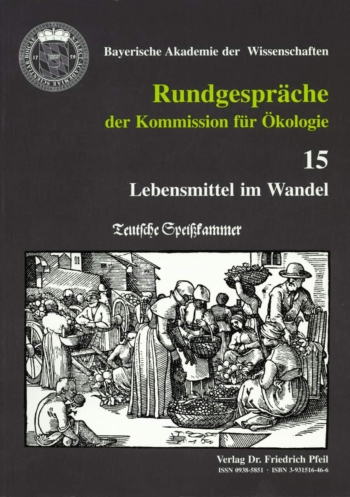
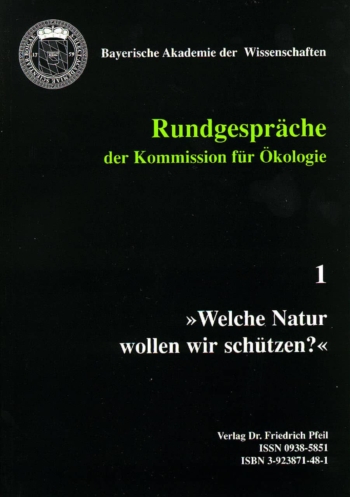
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.