2010 bezifferte die Ernährungs- und Landwirtschafts-Organisation der Vereinten Nationen (FAO) die Anzahl hungernder Menschen auf fast eine Milliarde. Das Millenniumsziel der Vereinten Nationen, diese Zahl bis 2015 zu halbieren, ist schwierig zu erreichen, umso mehr als die Weltbevölkerung pro Tag um 200000 Menschen zunimmt. Eine Ausweitung von Anbauflächen ist ohne große Schädigung unserer Naturreserven kaum mehr möglich; also muss auf den vorhandenen Nutzflächen effizienter produziert werden.
Die Ernährung der Menschheit beruht direkt oder indirekt ausschließlich auf dem Verzehr von Pflanzen. Seit dem Beginn der Landwirtschaft vor rund 10000 Jahren hat der Mensch zuerst durch Auslese von spontan auftretenden pflanzlichen Varianten, später durch gezielte Züchtung erfolgreich versucht, die Grundlagen der Ernährung aufrecht zu erhalten und wesentlich zu verbessern. Die Fortschritte in der Molekularbiologie, einschließlich der detaillierten Kenntnis gesamter Genome von Nutzpflanzen, haben in den vergangenen Jahrzehnten das methodische Spektrum der Pflanzenzüchtung nochmals ausgeweitet und ihr klassisches Potenzial erheblich gesteigert. Hinzu kam die Möglichkeit, Gene zwischen unterschiedlichen Organismen auszutauschen und so in kurzer Frist völlig neue Zuchtziele zu verwirklichen (Grüne Gentechnik). Moderner Resistenzzüchtung kann es gelingen, die weltweiten Ernteerträge um etwa ein Drittel anzuheben. Weitere Verbesserungen, die durch intensivere Förderung und vermehrten Einsatz der Pflanzenzüchtung ermöglicht werden könnten, sind z.B. erhöhte Dürreresistenz oder gesteigerte Nährwerte.
Organisation des Rundgesprächs: Prof. Dr. Widmar TANNER, Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang HABER und Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gerhard FISCHBECK.
Mit Beiträgen von: Christian GRUGEL, Wolfgang HABER, Klaus HAHLBROCK, Stefan MARCINOWSKI, Lilian MARX-STÖLTING, Ingo POTRYKUS, Felix PRINZ ZU LÖWENSTEIN, Matin QAIM, Theo RAUCH, Michael SCHMOLKE, Chris-Carolin SCHÖN, Widmar TANNER, Gerhard WENZEL.
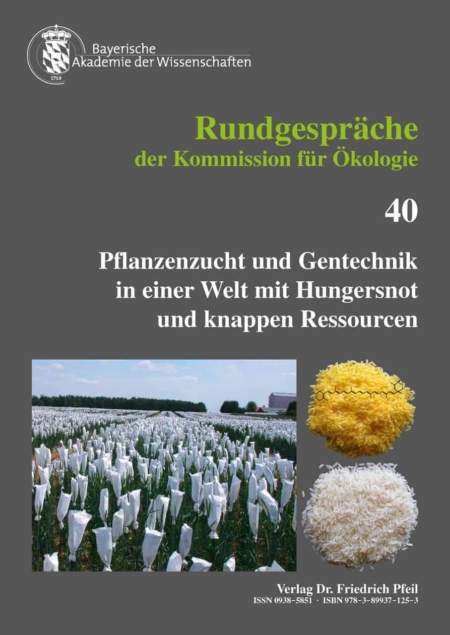
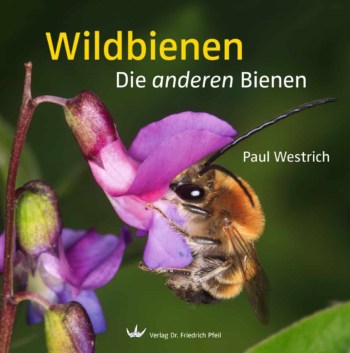
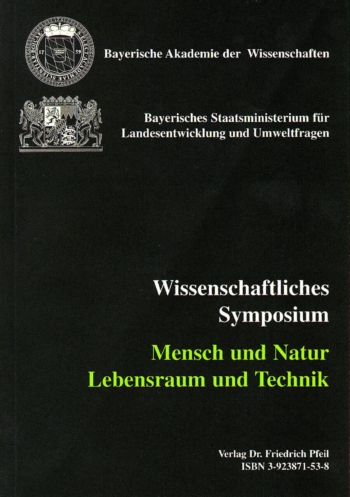
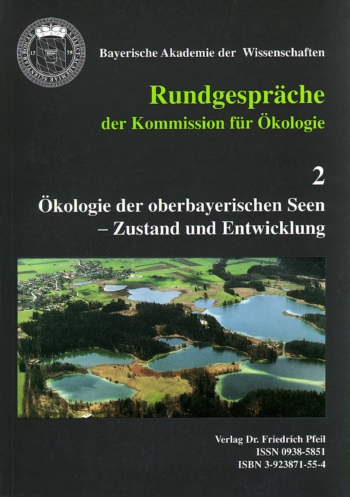
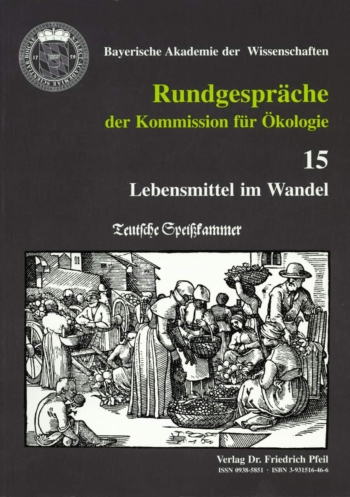
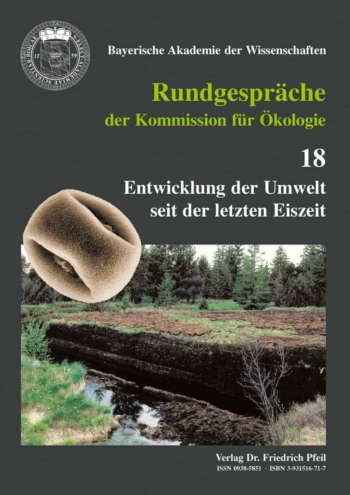
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.