Innerhalb der nächsten dreißig Jahre soll die Erzeugung von Strom aus Kernenergie in Deutschland beendet werden. Aber wie kann ihr derzeitiger Anteil von über 30 % ersetzt werden? Der Anteil regenerativer Energieformen liegt in Deutschland bei derzeit etwa 5 %. Wie und bis zu welcher Höhe kann er gesteigert werden? Und wie sehen die großen Energieversorgungsunternehmen diese Möglichkeiten, insbesondere angesichts der Liberalisierung des Strommarktes?
Vorgestellt wird die derzeitige Situation, der Stand der Technik sowie mögliche künftige Entwicklungen, aber auch derzeitige Hemmnisse und Beschränkungen für die Energieträger Wind, Wasser und Sonne. Aber auch welche Folgen ein nationaler Ausstieg aus der Kernenergie für die Sicherheit der noch laufenden Reaktoren in Deutschland sowie für den derzeit noch hohen internationalen Einfluss Deutschlands auf die Sicherheitskonzepte kerntechnischer Anlagen weltweit hat, wird diskutiert. Ebenfalls vorgestellt wird der Entwicklungsstand von Brennstoffzellen sowie von – in der Öffentlichkeit noch wenig bekannten – thermonuklearen Fusionsreaktoren.
Wie wichtig, aber auch schwierig es ist, die einzelnen innovativen Techniken und Rahmenbedingungen zu einer Klimaschutzstrategie zu kombinieren und diese dann möglichst wertfrei zu analysieren, wird anhand eines Modells gezeigt.
Organisation: Prof. Dr. Ing. Dr. Ing. e.h. Franz MAYINGER
Referenten: Adolf BIRKHOFER (Ges. für Anlagen- und Reaktorsicherheit mbH), Thomas BRUCKNER (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung e.V.), Kaspar Andreas FRIEDRICH (TU München), Michaele HUSTEDT (Bündnis 90/Die Grünen), Werner KLEINKAUF (Univ. GH Kassel), Joachim LUTHER (Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme), Franz MAYINGER (TU München), Arnulf SCHLÜTER (MPI für Plasmaphysik), Werner SÜSS (Bayernwerk AG), Erich TENCKHOFF (Siemens AG), Alfred VOSS (Univ. Stuttgart), Konrad WECKERLE (Bayernwerk Wasserkraft AG)
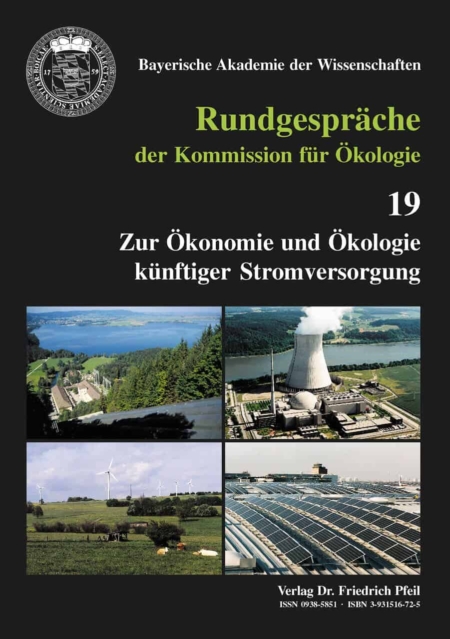
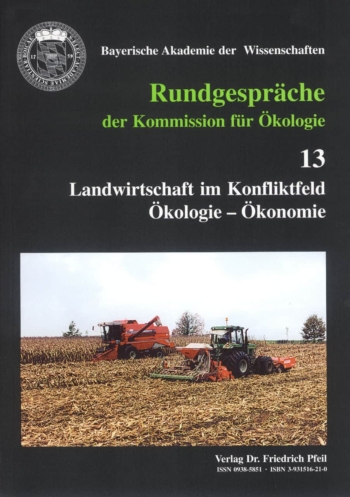
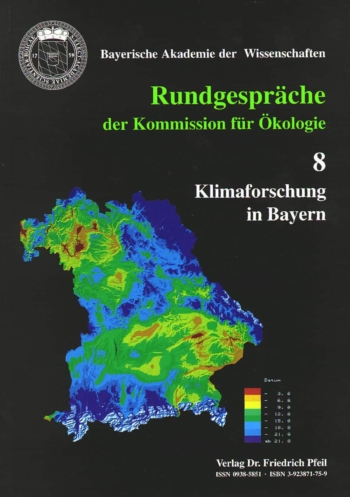
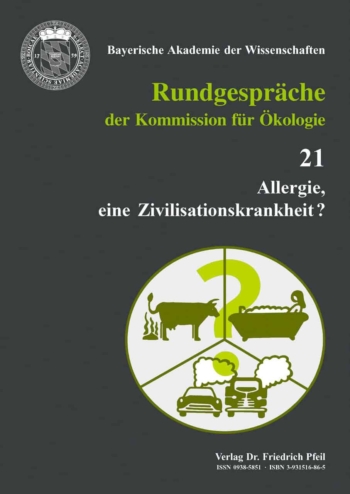
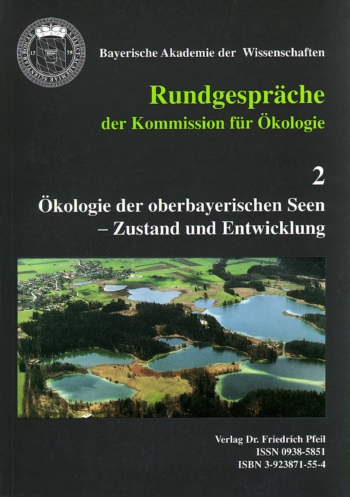
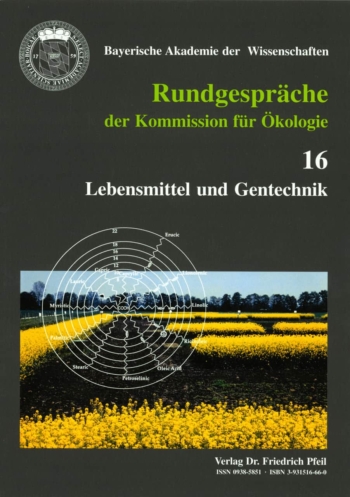
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.