Mit der Rekonstruktion der Stammesgeschichte und der Klassifikation der Organismen legen Biologen Grundlagen, auf denen Evolutionsforschung und Ökologie, aber auch moderne Genforschung und Bioinformatik aufbauen. Dieses Buch dient als Einführung in die Theorie der phylogenetischen Systematik und als Begleiter für alle, die morphologische oder molekulare Daten mit klassischen Methoden oder auch mit aktuellen Computerprogrammen analysieren möchten. Es werden die wissenschaftstheoretischen Grundlagen dargestellt, die unabhängig von den gewählten Analyseverfahren für jede Rekonstruktion der Phylogenese Bedeutung haben und Systematiker in die Lage versetzen, kritisch und objektiv die Qualität von Daten zu bewerten und Hypothesen zu entwickeln. Dazu gehören der Informationsbegriff, die Unterscheidung von Erkenntnis- und Ereigniswahrscheinlichkeit, das Sparsamkeitsprinzip, der Begriff der Homologiewahrscheinlichkeit, die Unterscheidung von phänomenologischen und modellierenden Methoden. Es wird erstmals ausführlich die Hennigsche Methode mit numerischen Verfahren verglichen und zwischen phänetischer und phylogenetischer Kladistik differenziert. Die in beliebten Computerprogrammen implementierten Auswertungsmethoden werden mit ihren axiomatischen Annahmen, Fehlerquellen und Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt. Für Wissbegierige sind zur Vertiefung einige mathematische Verfahren näher erklärt.
Dieses Buch ist auch in englischer Sprache erhältlich.
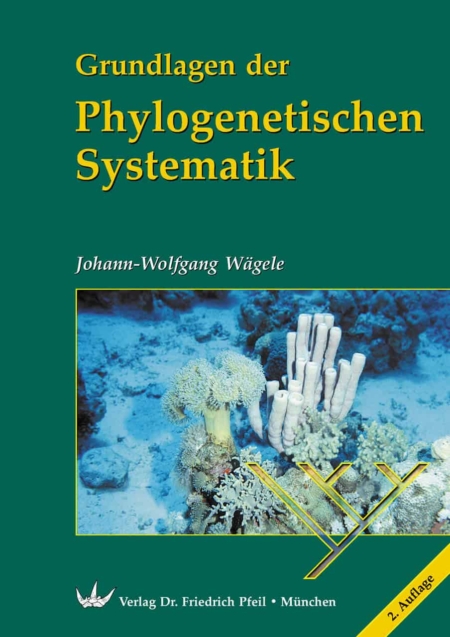
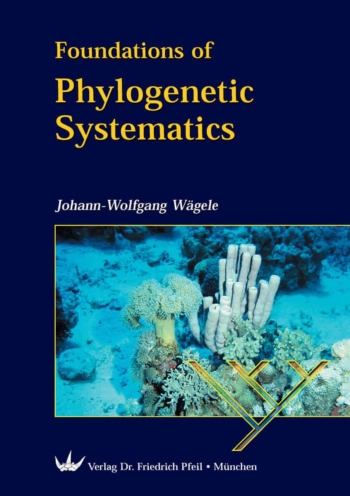
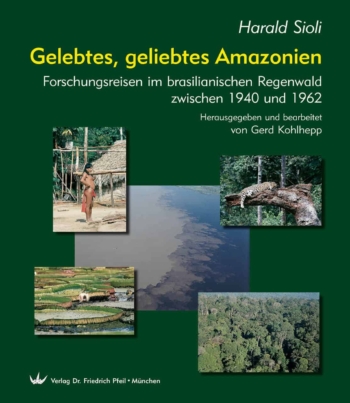
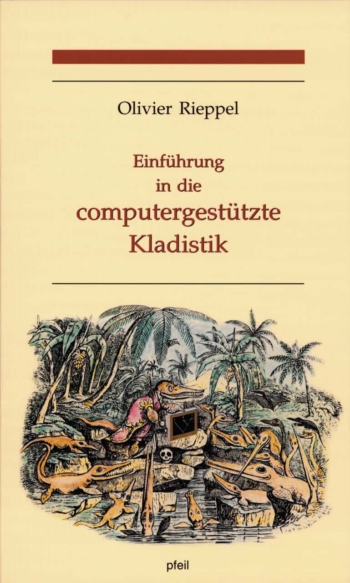
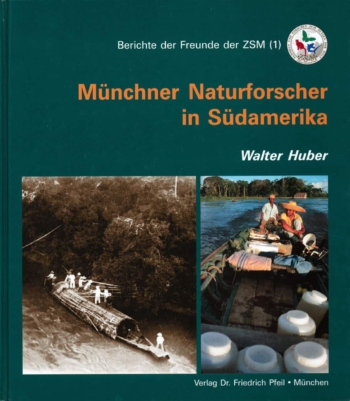
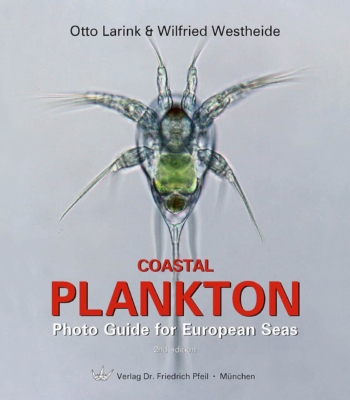
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.